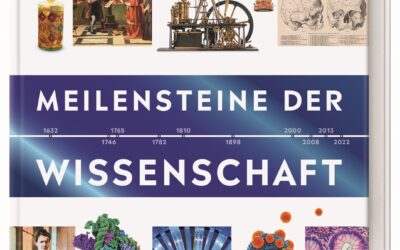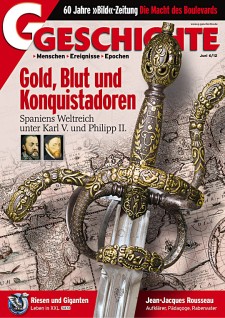Ode an den Forschergeist
Zum Blättern und Staunen: Ein reich bebilderter Band der wissenschaftlichen Errungenschaften der Menschheit. mehr lesen…
Medizin oder Droge oder beides?
Berliner Archäologen haben einen antiken, mit Giftsamen gefüllten Knochen gefunden. Wozu dienten die Körner? mehr lesen…
Eine runde Sache ohne Amerika
Kolumbus segelt nach Amerika, und Europa erfährt von der Neuen Welt — klingt einfach, ist aber in der Realität komplizierter. mehr lesen…
Putsch mit einer Blume und zwei Songs
Die Nelkenrevolution in Portugal beginnt mit einem Lied, das zuvor bei Europas Song-Contest nichts gerissen hat. mehr lesen…
Wer ist dein Held, mein Held, unser Held?
Eine Ausstellung in Rosenheim nimmt uns mit auf eine Spurensuche — durch verschiedene Epochen, in Wirklichkeit und Fiktion.
mehr lesen…
Dem Schicksal auf die Sprünge helfen
Seit Urzeiten probieren es Menschen mit Magie. Bis heute gilt: Je unsicherer die Zeiten, desto mehr Konjunktur hat sie. Das zeigt jetzt eine neue Ausstellung in Halle.
mehr lesen…
Was auf den Teller kommt … ist das Fake?
Eine interaktive Ausstellung über gefälschtes Essen gibt uns zu denken auf. Mit dabei: seltene Objekte aus 300 Jahren.
mehr lesen…
Schlau wie Asterix und stark wie Obelix
Die Gallier alias Kelten waren in vielerlei Hinsicht Pioniere. Jetzt können Kinder in einer Ausstellung ihre Zeit nacherleben.
mehr lesen…