Der Kabarettist Gerhard Polt über Besonderheiten des bayerischen Dialekts, eine unterschätzte Schlacht gegen die Preußen und die Frage, ob der Bayer einen Leithammel braucht, dem er folgen kann.

Gerhard Polt (M.) mit den G/GESCHICHTE-Redakteuren Christian Pantle (li.) und Dirk Liesemer (re.). | © Dirk Liesemer
Interview: Dirk Liesemer und Christian Pantle
G/GESCHICHTE: Herr Polt, es gibt einen britischen Humor, einen Wiener Humor, aber gibt es auch einen bayerischen?
Gerhard Polt: Ich bin oft schon gefragt worden, wie ich den bayerischen Humor empfinde. Dazu muss ich sagen: Ich persönlich kenne ihn nicht. Er ist mir nie begegnet. Natürlich kann man fragen: Was wäre bayerischer Humor, wenn es ihn gäbe? Ich sage: Humor ist immer dann, wenn er stattfindet. Der bayerische Humor steht und fällt mit dem Dialekt.
Was macht den bayerischen Dialekt so besonders?
Der bayerische Dialekt benutzt den Konjunktiv, den Irrealis. Ein Beispiel: „Na kunnt’s sei, dass ebn des ned gwen war“; dann könnte es sein, dass eben dem nicht so gewesen war. Es gibt dieses Spiel mit dem Irrealen, das tief im Denken der Bayern drin ist: Man kann bestimmte Dinge nicht präzisieren, sondern hält eine gewisse Vagheit aufrecht. Wenn Sie in eine bayerische Bäckerei gehen, dann sind Sie gut beraten, nicht zu sagen: „Bitte geben Sie mir zwei Brötchen“, sondern: „I dad a no gern zwoa Brod ham, wenn’s es hätts“, also: Ich täte gerne noch zwei Brote haben, wenn ihr welches hättet.
„Der Kabarettist Werner Finck liebte es, Dinge anzudeuten, um die Menschen zum Weiterdenken zu verleiten“
Wird so etwas vor allem von bayerischem Publikum verstanden?
Vielleicht. Aber Loriot hat mir gegenüber mal gemeint: Für ihn klingt es versöhnlicher, wenn ein Bayer etwas Tragisches sagt, als wenn es andere in ihren Dialekten sagen. Ich fand das sehr nett.

Gerhard Polt auf der Bühne, 2015. | @ Wikimedia/Jörgens.mi/CC BY-SA 3.0
Das Kabarett entstand um die Wende zum 20. Jahrhundert in Paris und Berlin, später auch in München. Wenn Sie zurückdenken, welcher bayerische Kabarettist fällt Ihnen als erster ein?
Er war zwar kein Bayer, hat aber in Bayern gelebt: Werner Finck. Schon vor dem „Dritten Reich“ hatte er einen Namen. Man kann ihn in seiner Vortragsweise mit Dieter Hildebrandt vergleichen: Er liebte es, Dinge anzudeuten, um die Menschen zum Weiterdenken zu verleiten. Einmal, während der NS-Zeit, saß ein Spitzel unten im Publikum und schrieb alles mit. Da sagte Finck von der Bühne herab zu ihm: „Kommen Sie mit, oder muss ich mitkommen?“ Er kam später in eine Art Strafbataillon, was er aber überlebte.
Haben Sie in Schwabing, wo Sie aufgewachsen sind, etwas von der dortigen Kabarettszene aufschnappen können?
Ich kannte Jazzkeller, in denen Kabaretts stattfanden und wo sich ein bestimmtes Milieu versammelte: Maler, Schriftsteller, Karikaturisten. Einmal, in einem Lokal in der Türkenstraße, habe ich den Dichter Eugen Roth kennengelernt, was mich beeindruckt hat. Aber bevor ich Kabarettist wurde, war ich am Theater, an den Münchner Kammerspielen.
„Eine angenehme Eigenschaft des Bayerischen: Jemanden in seinem Glauben zu lassen“
Lange war das Kabarett in den Großstädten daheim. Anfang der 1970er-Jahre kam es aufs Land. Erinnern Sie sich noch, wie das vor sich ging?
Kabarett hieß damals: Intellektuelle machen ein Programm für Intellektuelle. Parallel dazu gab es aber die Brettlkunst, also das, was man heute Kleinkunst nennt. Sie war volkstümlicher – was nicht heißt, dass sie nicht politisch wirkte. Vorstadtbrettl hat man gesagt. Es waren dann die Brettlkunst und Formationen wie die Biermösel Blosn, die das Kabarett in den 1970er-Jahren aufs Land und in die Bierzelte brachten. Nicht vergessen sollte man dabei auch, dass es in der bayerischen Volksmusik immer schon sozialkritische Stücke gab, etwa über das Soldatendasein.
Hin und wieder greifen Sie auch historische Themen auf. Wie schwierig ist es, diese dem Publikum verständlich zu machen?
Ich bin grundsätzlich nicht so sehr aktuell – ich versuche, akut zu sein. Auf der Bühne erzähle ich gerne von etwas, das keiner kennt. Man kann zur Schlacht von Ampfing alles Mögliche behaupten: Wenn die Schlacht nicht gewesen wäre, dann wäre der Bierpreis heute niedriger oder höher, je nachdem. Es ist wie in der Politik: Man sagt, dieses oder jenes sei Fakt, aber bleibt alle Belege schuldig. Wir können das ja sehr gut bei Herrn Trump beobachten.
Oft behaupten Menschen auch im besten Glauben, dieses oder jenes sei so oder so gewesen, aber tatsächlich stimmt es nicht. Übrigens ist auch das für mich eine angenehme Eigenschaft des Bayerischen: jemanden in seinem Glauben zu lassen. Man muss nicht immer ein Aufklärungsfanatiker sein. Bayern hat viele Künstler, Schauspieler und Maler hervorgebracht, aber besserwisserische Bohrer eher nicht so viele. Vielleicht sitze ich da aber auch einem Klischee auf.

2020 erhält Polt den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München. | @ Wikimedia/Dieter Schnöpf
Apropos Klischee – Sie sollen mal gesagt haben: „Die Zahl der bayerischen Klischeeträger wird immer kleiner, das Klischee aber seltsamerweise immer größer.“
Ja, da ist was dran. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man sich heutzutage nicht mehr so in die anderen hineinversetzt, weil man andere Sprachen außer Englisch kaum mehr lernt. Die Leute fahren überall hin, aber sie kommen nirgendwo mehr an. Früher gab es hier am Schliersee Treuenadeln für Leute, die 40 Jahre lang jeden Urlaub am gleichen Ort verbracht haben. Das gibt es fast nicht mehr.
Existieren noch Klischeeträger in Bayern?
Wahrscheinlich schon. Das Wort „Klischee“ hat eine komplizierte Geschichte. Historische Figuren von König Ludwig II. bis Franz Josef Strauß sind nicht zuletzt auch Klischeefiguren.
„Natürlich haben bayerische Fürsten kalkuliert, sind taktisch vorgegangen“
Ist es ein Klischee, dass sich die Bayern in der Geschichte immer rechtzeitig und opportunistisch dem Sieger angeschlossen haben? Mal Preußen, mal Napoleon, mal Österreich.
Ich bin da vorsichtig, weil ich kein Kontinuum sehe. Natürlich haben bayerische Fürsten kalkuliert, sind taktisch vorgegangen. Aber ist das jetzt bayerisch oder doch eher allgemein menschlich? König Ludwig II. war wirklich kein Freund des Krieges gegen die Franzosen in den 1870er-Jahren, er wollte keinen deutschen Kaiser und kein Deutsches Kaiserreich. Aber nach der Schlacht bei Königgrätz 1866 sah er sich dazu gezwungen, all die ihm widerstrebenden Dinge anzuerkennen. Hätten die Bayern und Österreicher die Schlacht nicht gegen Preußen verloren, wäre wahrscheinlich der gesamte Geschichtsverlauf anders gewesen. Vielleicht wird die Bedeutung dieser Schlacht unterschätzt.
Danach hat sich Bayern jedenfalls unverbrüchlich an Preußen gebunden.
Ja, aber sie hatten den Krieg verloren, und dann wurde Österreich aus dem Deutschen Reich ausgeschlossen, was eigentlich ein ziemlich irrer Vorgang war. Aber wie gesagt: Nicht nur Bayern können sich opportunistisch verhalten.
Als Machtmenschen sind die bayerischen Könige gleichwohl nie aufgefallen. Woran liegt das?
Das ist schon richtig, die Wittelsbacher haben in der Bevölkerung meist einen guten Stand gehabt, sie waren offenbar umgänglicher als andere Herrscher. Vielleicht förderte das auch die Identifikation mit dem Land. Historisch finde ich es jedenfalls hochinteressant, dass man in der Weimarer Republik noch Prinz Rupprecht von Bayern gegen Hitler aufstellen wollte – vielleicht hätten die Monarchisten den Faschisten genug Stimmen gekostet. Und das Landesbewusstsein der Bayern ist so ausgeprägt, dass mir mal ein bayerischer Oppositionsführer sagte: Wenn sich die bayerische SPD nicht SPD genannt hätte, sondern SPB, also Sozialdemokratische Partei Bayerns, dann wäre sie wohl beliebter. Aber so haftet an ihr der Geruch von Berlin.
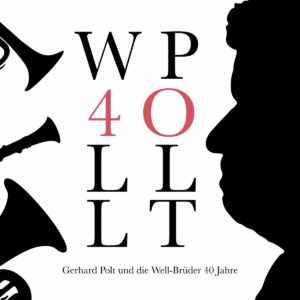
CD- & Vinyl-TIPP: Gerhard Polt und Die Well Brüder: „40 Jahre“. JKP/Warner 2020, ab € 16,99
Würden Sie sagen, dass die Bayern eine besonders innige Haltung zu ihrer Obrigkeit pflegen? Es gibt den Satz: Der Bayer liebt die Anarchie, aber mit einem starken Anarchen an der Spitze.
Der Wunsch, einem Leithammel mit einer Glocke zu folgen, scheint in manchen Nationen stärker, in anderen schwächer zu sein. Vielleicht haben die Bayern diesen Wunsch stärker als die Holsteiner.
Vielleicht spielt aber auch die Religion eine nicht unwichtige Rolle. Letztlich existieren in Europa drei Nationen: eine evangelische, eine katholische und eine orthodoxe. Und das katholische Element ist in Altbayern, wo ich lebe, bis heute vorhanden. Über die Jahrhunderte hat die katholische Erziehung zu eigenen Ausdrucksformen geführt. So hätte es den Bayerischen Barock sicher nicht gegeben, wenn sich zuvor der Protestantismus im bayerischen Süden durchgesetzt hätte. Auch die öffentlichen Prozessionen sind das Gegenteil eines nach innen gekehrten pietistischen Schamgefühls. Man kann das katholische Element ebenso im Umgang mit Alkohol erkennen, in der italienisch geprägten Ästhetik, im Theater und überhaupt im Auftreten – je südlicher, desto theatralischer.




